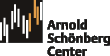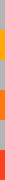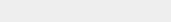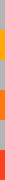
|
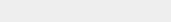
Titel
Werkgattungen
Papiersorten
Volltextsuche
Kategoriensuche
Verknüpfte Suche
|
Sie befinden sich hier: Alle Titel / Konzert für Violoncello und Orchester D-Dur nach dem Concerto per Clavicembalo, Matthias Georg Monn - A. Orchesterfassung
| Konzert für Violoncello und Orchester D-Dur nach dem Concerto per Clavicembalo, Matthias Georg Monn
A. Orchesterfassung
| | Entstehungszeitraum: | 11.11.1932-04.01.1933 | | Uraufführung: | Offiziell 7. November 1935, London (Emanuel Feuermann, Violoncello; London Philharmonic Orchestra; Sir Thomas Beecham, Dirigent); inoffiziell 3. Februar 1933, London (Antonio Sala, Violoncello; Edward Clarks, Dirigent) | | Quellen: | | | Weitere Quellen: | |
| | Beschreibung: | Das Konzert für Violoncello und Orchester D-Dur entstand im Winter 1932/33 auf Anregung von Pablo Casals, der im Jahre 1913 das von Schönberg mit einer Generalbaß-Aussetzung versehene Violoncellokonzert g-Moll von M.G. Monn in Wien uraufgeführt hatte.
Casals gab aber nur den äußeren Anlaß zur Komposition des Violoncellokonzerts. Gegen Ende der 1920er Jahre drohte der Zwölftonmusik die Gefahr, daß man in ihr die letztmögliche Entwicklungsstufe der Romantik sah, deren Ablösung durch die Neue Sachlichkeit der Zeitgeist forderte. Schönberg, der diese stilistische Kunstrichtung, die Methode nämlich, das frühere 18. Jahrhundert zu kopieren und zugleich durch Zusätze zu verfremden, mit Distanz betrachtete, antwortete zunächst mit seinem op. 28, Drei Satiren für gemischten Chor (1925/26).
Es erscheint möglich, daß diese Auseinandersetzung für Schönberg, der es verabscheute, als Revolutionär bezeichnet zu werden, bis zu seiner Abreise von Europa im Jahre 1933 ein zentrales Anliegen gewesen war. Er begann, Aufsätze über Tonalität zu schreiben. Am 22. Oktober 1930 hielt er in Prag einen Vortrag (Neue Musik, veraltete Musik, Stil und Gedanke), in dem er eine geschichtliche Parallele zwischen seiner und Bachs Situation zweihundert Jahren zuvor zog, als nämlich der komplizierte Kompositionsstil Bachs für veraltet und überholt galt, dem man eine einfachere, gefälligere Schreibweise als Ausdruck von zukunftsweisenden Kunstrichtungen entgegenhielt. Schönbergs Argumentation war von derselben Überzeugung getragen, die sich musikalisch in seinen Instrumentalkonzerten nach älteren Vorbildern dokumentierte. Sein Rückgriff in die Geschichte ist nicht der Versuch, den musikalischen Problemen der Gegenwart auszuweichen, sondern die Suche im Vergangenen nach dem Zukünftigen; nur unter dieser Voraussetzung historischer Reflexion kann die Anknüpfung an ältere Werke fruchtbar sein.
Die ersten Überlegungen zu einer Komposition für Violoncello finden sich in einem handschriftlichen undatierten Briefentwurf, als dessen Adressat wohl Pablo Casals angenommen werden muß; das Konzept entstand wahrscheinlich während Schönbergs Aufenthalt in Barcelona im Winter 1931/32:
Sie fragten mich gestern, ob ich denn nicht ein Violoncell=Stück schreiben würde. Ich antwortete Ihnen: ich habe oft daran gedacht und es x=mal vorgehabt. Ich hätte Ihnen mehr sagen können: ich hatte nämlich eben vorhin wieder daran gedacht, weil mir Ihr Spiel fabelhafte Lust dazu gemacht hatte; und weiter, welche Pläne ich habe.
Nun will ich es wirklich tun und möchte doch die kurze Zeit vor meiner Abreise noch benutzen, um - denn ich möchte das Stück für Sie schreiben und habe Ihnen bereits längst „Maß-genommen“ - ein paar Ideen mit Ihnen zu besprechen. Ich will kurz einige andeuten:
1. Eine Phantasie über ein Bach-Stück (ein schönes Adagio oder Menuett Gavotte oder dgl.) eventuell in Variationenform; oder
2. Eine Klavier-Suite oder eine Trio-Sonate oder dgl. cellomäßig umdeuten.
3. Eine dieser Arbeiten entweder
a) für Cello Solo oder
b) " Cello mit Klavier oder
c) " Cello mit Orchester.
Ich kann mich nicht entscheiden, ohne die Noten zu sehen. Wenn ich ein Stück von Bach hätte, weiß ich nicht, ob ich nicht gleich anfangen würde.
Ein Jahr später griff Schönberg auf das Concerto per Clavicembalo D-Dur von M.G. Monn (1746) zurück, das zusammen mit dem schon erwähnten Violoncellokonzert g-Moll desselben Komponisten die Gruppe „Konzerte“ im zweiten Teil des XIX. Jahrgangs der Denkmäler der Tonkunst in Österreich vertritt; es handelt sich also nicht um eine zweite Bearbeitung des Violoncellokonzerts g-Moll, wie Rudolf Lück in seinem Artikel Die Generalbaß-Aussetzungen Arnold Schönbergs (in: Deutsches Jahrbuch der Musikwissenschaft VIII, 1963, S. 28) fälschlich annimmt. Schönbergs letzte in Berlin abgeschlossene Instrumentalkomposition wurde am 11. November 1932 begonnen und am 4. Januar 1933 beendet. In den autographen Quellen des Violoncellokonzerts sind folgende Daten belegt:
Partitur
11. November 1932 für den Kompositionsbeginn (B, S. 1)
11. Dezember 1932 für den Abschluß des I. Satzes (B, S. 32)
16. Dezember 1932 für den Abschluß der Skizzierung des II. Satzes (A, S. 6v)
23. Dezember 1932 für den Abschluß des II. Satzes (B, S. 34)
23. Dezember 1932 für den Beginn der Niederschrift des III. Satzes (B, S. 35)
4. Januar 1933 für den Abschluß des III. Satzes (B, S. 56)
Der Klavierauszug wurde zwischen dem 7. und dem 11. März 1933 niedergeschrieben:
Klavierauszug
7. März 1933 für den Abschluß des I. Satzes (H, S. 15)
10. März 1933 für den Abschluß des II. Satzes (H, S. 22)
11. März 1933 für den Abschluß des III. Satzes (H, S. 33)
Die Vollendung des Werkes teilte Schönberg schon am 7. Januar 1933 dem Dirigenten Hans Rosbaud mit:
Lieber Herr Rosbaud, entschuldigen Sie, bitte. Ich habe einerseits gearbeitet und andrerseits, weiß ich noch immer nicht, welchen Vortrag ich bei Ihnen halten soll. (Ich habe seit zwei Tagen ein Cellokonzert mit Orchester „in freier Umgestaltung nach einem Klavierkonzert von Monn (1746)“ fertig, dessen Uraufführung ich mit Casals zusammen machen möchte: London will mich dazu für die nächste Saison engagieren; aber ich würde es, wenn Casals Zeit hat, gerne noch in dieser machen. Ich sage Ihnen das ganz offen: vielleicht sind Sie der Meinung, dass Frankfurt sich dafür interessieren würde; dann habe ich eine Türe aufgemacht. Aber bitte: ohne Zwang; beiderseits! Denn ich möchte das nicht ganz billig tun [...]
Am nächsten Tag sondierte Schönberg bei der Universal-Edition, Wien, die Chancen für die Abtretung des Verlagsrechts gegen ein Honorar von 2000 Dollar; die Antwort des Verlags vom 12. Januar 1933 fiel negativ aus. Am 20. Februar, nach seiner Rückkehr aus Wien, wo er am 15. Februar seinen Vortrag Neue Musik, veraltete Musik, Stil und Gedanke gehalten hatte, schlug er Pablo Casals in einem Brief vor, das ihm gewidmete Werk gemeinsam zur Uraufführung zu bringen. Es steht fest, daß Casals bald mit den Proben begann, zum Datum einer Aufführung allerdings äußerte er sich in einem Brief an Schönberg vom 22. Juli 1933 eher zurückhaltend:
Ich kann Ihnen nur sagen, daß ich unentwegt am Konzert von Monn arbeite – ich habe noch nie ein so schwieriges Werk studiert und - um Ihnen meine Bewunderung zu bezeugen – die Schwierigkeiten sind so vielfältig, daß es zuviel gesagt wäre, den Zeitpunkt festzulegen, wann das Werk der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann ...
Die von Schönberg gewünschte Zusammenarbeit kam nicht zustande; Casals spielte das Konzert nur privat. Die Gründe dafür könnten ähnlich gewesen sein, wie sie in dem Bericht des Cellisten Gregor Piatigorsky in dessen Autobiographie zum Ausdruck kommen, den Schönberg während seiner Tournee durch die Vereinigten Staaten für die Aufführung des Konzerts zu gewinnen suchte:
Schönberg hat mir sein Cello-Konzert das auf Musik von Monn basierte gegeben und mich gefragt, ob ich es spielen wollte. Ich hatte schon daran gearbeitet, aber im Gegensatz zu seinen anderen reizvolleren Werken gab mir dieses Rätsel auf, und ich mußte mich immer wieder damit beschäftigen. Ich hoffte, daß ich vielleicht am Ende dieser Reise besser verstehen würde, was einen Meister von Schönbergs Größe dazu bewog, sich auf Monn zu stützen.
Für Schönberg bedeutete die Aufführung des Violoncellokonzerts sehr viel: es war – sieht man von den Volksliedbearbeitungen ab – sein erstes großes tonales Werk seit mehr als 25 Jahren, nachdem er mit der Kammersymphonie op. 9 die Grenzen der Tonalität erreicht hatte. Für dieses Konzert, wie auch für sein nächstes Instrumentalkonzert nach G. F. Händel, hat Schönberg den Begriff „freie Umgestaltung“ eingeführt, um das Eingreifen in die verschiedenen Ebenen der Vorlage zu bezeichnen; damit wird ein Verfahren angedeutet, das hinsichtlich der Form und der Harmonik älterer Werke ähnliche Funktion erfüllt wie eine die Satzstruktur erhellende analytische Instrumentation, nämlich die im Werk angelegten Tendenzen aufzudecken.
Die Uraufführung fand am 7. November 1935 in London im Rahmen eines Festkonzerts zu Ehren von Jean Sibelius statt ; Emanuel Feuermann spielte den Cellopart, begleitet vom London Philharmonie Orchestra unter der Leitung von Sir Thomas Beecham.
Der Originaldruck der Partitur erschien 1936 im Verlag G. Schirmer, New York.
(GA Reihe B, Band 27,2, S. XIV f.) | | Besetzung: | Orchester, Violoncello | | Gattung: | Bearbeitungen --> Instrumentalkonzerte nach Werken alter Meister
| | beteiligte Personen: | Pablo (Pau) Casals (1876-1973) - Widmungsträger(in)
Matthias Georg Monn (1717-1750) - Komponist(in)
|
| | Erstdruck: | G. Schirmer, Inc. New York | | Gesamtausgabe: | Reihe A, Band 27/2; Reihe B, Band 27/2 |
zurück
|
|