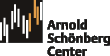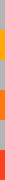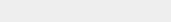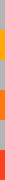
|
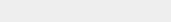
Titel
Werkgattungen
Papiersorten
Volltextsuche
Kategoriensuche
Verknüpfte Suche
|
Sie befinden sich hier: Alle Titel / Friede auf Erden
| Friede auf Erden
| | Opus: | op. 13 | | Entstehungszeitraum: | 09.03.1907-06.10.1911 | | Uraufführung: | 9. Dezember 1911, Wien, Großer Musikvereinssaal (Philharmonischer Chor, Wiener Lehrergesangsverein, Wiener Tonkünstlerorchester; Franz Schreker, Dirigent). | | Quellen: | | | Weitere Quellen: | |
| | Beschreibung: | Schönbergs Chor Friede auf Erden steht chronologisch zwischen der Kammersymphonie op. 9 und dem II. Streichquartett op. 10. Äußerer Anlaß zur Komposition des Chorwerks war, so berichtet Egon Wellesz, ein Preisausschreiben; doch ebenso wie die zu einem ähnlichen Zweck geschriebenen Balladen op. 12 wurde auch der Chor nicht mit einem Preis bedacht.
Wann Schönberg mit der Komposition des Werks begonnen hat, ist nicht bekannt. Die frühesten Aufzeichnungen - wenige Skizzen und die Erste Niederschrift des Chorsatzes (A) - befinden sich auf den S. 49-56 des III. Skizzenbuchs zwischen den Datierungen 14.8.1906 (auf S. 33 = Sk 218) und 9.3.1907 (auf S. 57 = Sk 235). Am 9. März 1907 vollendete Schönberg die Niederschrift des Chorsatzes (B); noch am gleichen Tag wurden die ersten Skizzen zum II. Streichquartett niedergeschrieben. In die Entstehungszeit von Friede auf Erden fällt die Vorbereitung eines Konzerts des Chormusikvereins, den Schönberg in der Saison 1906/07 leitete; das Programm dieses Konzerts, das am 24. Februar 1907 stattfand, enthielt auch - dies mag hinsichtlich des Beginns des Chorsatzes in op. 13 von Bedeutung sein - eine Reihe von Werken alter Musik (u. a. von Haßler und Senfl).
Im Jahre 1908 wurde der Chor op. 13 - so ist einer Bemerkung David Josef Bachs zu entnehmen - im Singverein unter Franz Schalk geprobt, mußte jedoch wegen seiner Schwierigkeit aufgegeben werden. Zur Unterstützung dieser Proben entstand auch der von Anton Webern angefertigte Klavierauszug, der später im Originaldruck (ohne Angabe des Autors) unter der Chorpartitur abgedruckt wurde. Die Erstniederschrift des Webernschen Klavierauszugs befindet sich heute in der Paul Sacher Stiftung (Basel); die für die Proben unter Schalk hergestellte Partitur (D) setzt sich aus der wahrscheinlich von Erwin Stein angefertigten Chorabschrift und dem von Webern darunter eingetragenen Klavierauszug zusammen. Vielleicht steht die Bemerkung, die Schönberg der (undatierten) Reinschrift des Chorsatzes (C) beifügte, in Zusammenhang mit den gescheiterten Proben unter Schalk:
Dieser Chor ist womöglich ohne Begleitung (a capella) auszuführen; nur für den Fall, als die Reinheit der Intonation ausbleiben sollte, ist die Orgel zur Begleitung heranzuziehen.
Die erwähnte Mitteilung D.J.Bachs ermöglicht zudem einige Vermutungen über Datierung und Schicksal der Quellen C (Reinschrift) und D (Abschrift des Chorsatzes mit Klavierauszug) : beide tragen, obgleich sie sich heute nicht mehr dort befinden, den Stempel Gesellschaft der Musikfreunde in Wien mit der Katalognummer 32388 und wurden dort in der Zeit zwischen Juli 1906 und September 1910/11 - also jedenfalls vor der Uraufführung des Werks mit dem Philharmonischen Chor unter Franz Schreker am 9.12.1911 - inventarisiert. Beide Quellen wurden demnach wohl für die Proben des Singvereins im Jahre 1908 benutzt und gelangten so in das Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde. Für die Proben zur Uraufführung wurden sie aufs Neue benötigt, doch dann offensichtlich nicht mehr an das Archiv zurückgegeben. Auch die Chorstimmen befanden sich ursprünglich in der Anzahl 100/100/50/80 im gleichen Archiv, heute liegen dort nur noch eine einzige Sopranstimme (E2) sowie sechs Tenorstimmen (El). Aus dem Briefwechsel zwischen Schönberg und dem Verleger Dr. Gerhard Tischer (s. u.) geht hervor, daß das Notenmaterial nach der Uraufführung im - heute verschollenen - Archiv des Philharmonischen Chors aufbewahrt wurde.
Die Planung der Uraufführung mit dem von Schreker gegründeten Philharmonischen Chor begann bereits zu Beginn des Jahres 1911; Schreker berichtete in einer Karte an Schönberg, er werde sich die Chorstimmen bei der Gesellschaft der Musikfreunde ausleihen und Anfang März mit den Proben beginnen. Gleichzeitig regte er die Anfertigung einer Unterstützung mit Streichorchester an, denn es wird Schwierigkeiten geben.
Zur Vorbereitung der Proben arbeitete Schreker mit der um einen Klavierauszug erweiterten Chorpartitur (D), bat dann jedoch wegen der schlechten Lesbarkeit um eine II. Partitur des Chors; vermutlich lieh Schönberg Schreker daraufhin die Reinschrift (C) des Werks aus, die von da an bei den Proben zusätzlich zu Rate gezogen werden konnte.
Kurz vor dem Beginn der Chorproben nach dem Ende der Sommerpause, Mitte September, mahnte Schreker die versprochene Instrumentalbegleitung des Chors bei Schönberg an:
[...] Ist die Partitur zu Friede auf Erden fertig? [...] Wenn nicht - Sie könnten Sie für vollständiges Orchester machen - es steht zur Verfügung. Schönberg forderte daraufhin - dies läßt sich wiederum aus Schrekers Antwort schließen - die bei Schreker befindliche Partitur (C) zurück, aus der er die Orchesterbegleitung herstellen wollte; doch Schreker konnte dieser Bitte nicht nachkommen:
Ich kann Ihnen die Partitur erst Montag oder Dienstag zuschicken lassen. Montag beginnen nämlich die Proben. [...] Die Sache ist fatal, denn solange ich Ihre Partitur nicht zurück habe, kann ich mit dem Chor nicht proben, was dem Studium wenig zustatten kommt.
Die Situation wurde zusätzlich dadurch kompliziert, daß Schönberg wegen nachbarlicher Zwistigkeiten Wien im August fluchtartig verlassen hatte; nachdem er sich zunächst am Starnberger See aufgehalten hatte, war er dann Ende September überraschend nach Berlin übergesiedelt. Dieser Umstände wegen hatte er in Berlin zur fraglichen Zeit wahrscheinlich nicht einmal die Erste Niederschrift des Chors (B) zur Hand.
Wenig später - nach der ersten Chorprobe - schlug Schreker folgendes zur Lösung des geschilderten Problems vor:
[...] ich werde versuchen, die Partitur copieren zu lassen; und er fügt hinzu: wenn Sie die Begleitung für ganzes Orchester machen, ist's mir schon recht - ich verstehe Sie vollkommen - nur der Streicherklang allein für die vielen großen Steigerungen hätte mir nicht verständlich erschienen. Ich berichtete gestern über den günstigen Erfolg der ersten Probe. Wann kommen Sie nach hier? Bleiben Sie denn noch so lang dort?
Die von Schreker in Auftrag gegebene Abschrift von C, nach deren Vorlage Schönberg schließlich die Orchesterbegleitung herstellte, hat sich erhalten (F) ; sie trägt das Abschlußdatum 24. September 1911 und enthält zu Anfang sogar einige Instrumenteneintragungen von Schönbergs Hand. Die Orchester-Partitur (G) schloß der Komponist am 6. Oktober in Berlin ab. In seinem Dankesschreiben meinte Schreker:
[...] sie entspricht vollständig dem, was ich mir vorgestellt habe, und er äußerte sein Bedauern darüber, daß Schönberg nun endgültig nach Berlin übergesiedelt sei; er hoffe, ihn am Tag der Uraufführung in Wien begrüßen zu können.
Die Herstellung von Orchesterstimmen (I*) war inzwischen bei der Universal-Edition in Auftrag gegeben worden. Am 4. November schrieb Schreker u. a. wegen der Herstellung des Stimmenmaterials an Schönberg:
Ihr Chor kommt am 9. Dezember. Es geht sehr gut, wenn der Verstärkungsmännerchor nicht einiges (da er nur vier Proben hat) von den dynamischen Feinheiten raubt, hoffe ich das Aller-beste. [...] Nur bitte, ersuchen Sie Herrn Berg, er möge die Orchesterstimmen, die hoffentlich Hertzka rechtzeitig liefert, einmal durchsehen in punkto Fehler - ich hätte, falls sie schlecht sind, schwer Zeit zu einer Korrekturprobe.
Schrekers Andeutung genügte, um Schönberg in äußerste Sorge zu versetzen; das Risiko einer mißlungenen Aufführung wollte er keinesfalls eingehen, er hätte es sogar vorgezogen, den Chor gegen die früheren Orchesterlieder op. 8 auszutauschen. Am 17. November wandte er sich in dieser Sache an Hertzka:
Jetzt etwas sehr Wichtiges! Schreker fragt wegen der Begleitstimmen für meinen Chor! Sind die schon fertig? Berg, Polnauer und Linke werden sie korrigieren. Bitte, das ist höchst dringend!! Schreker braucht sie doch wenigstens 8-10 Tage vor der Aufführung und ebenso lange braucht man zum Korrekturlesen!
Das Stimmenmaterial wurde bis zum 4. Dezember 1911 fertiggestellt (Streicherstimmen in der Anzahl 8/6/6/5/4), außerdem eine Abschrift der Partitur; all dies läßt sich aus einem Eintrag in G schließen. Es ist übrigens durchaus denkbar, daß die erwähnte Partitur-Abschrift (H*) - sie ist heute verschollen - die Partituren von Chor- und Orchestersatz kombinierte, wie es für die Schrekersche Aufführung notwendig war; in dieser Weise ist auch die von Felix Greissle für die Aufführung unter Webern hergestellte Partitur angelegt.
Das VI. Statuarische Konzert des Philharmonischen Chors fand unter Leitung von Franz Schreker und unter Mitwirkung des Männerchors des Wiener Lehrergesangvereins und des Wiener Tonkünstler-Orchesters am 9. Dezember 1911 im Großen Musikvereinssaal statt.
(Okuljar, Tadeusz; Sichardt, Martina: GA, Reihe B, Bd. 18, Teil 1, S. XXI-XXII)
Die frühesten Quellen - die unvollständige Erste Niederschrift mit nur wenigen Skizzen (A), die vollständige Niederschrift (B) und die Reinschrift (C) - enthalten ausschließlich den Chorsatz.
Die Chorstimmen - nur wenige sind erhalten: eine Sopranstimme (El) und sechs Tenorstimmen (E2) - wurden vermutlich im Zusammenhang mit den Proben unter Franz Schalk (1908) hergestellt. Aus dem gleichen Anlaß wurde auch - wohl von Erwin Stein - eine Abschrift des Chorsatzes (D) angefertigt, die unterhalb der Chorpartitur einen Klavierauszug enthält, den Anton Webern verfaßt und in diesem Manuskript auch geschrieben hat.
Im Zuge der Vorbereitungen der Uraufführung im Jahre 1911 wurde eine Kopisten-Abschrift (F) der Reinschrift (C) in Auftrag gegeben; aus F stellte Schönberg die von Schreker angeregte Orchesterbegleitung (G) her. Kurz vor der Uraufführung wurde das Orchestermaterial (I*) sowie eine Kopisten-Abschrift (H*) der Orchesterbegleitung (G) angefertigt.
Für den Originaldruck (J1), der im Jahre 1912 bei Tischer & Jagenberg erschien, diente F als Stichvorlage des Chorsatzes und D als Stichvorlage des Klavierauszugs. Noch im gleichen Jahr brachte der Verlag eine 2. Ausgabe (J2) heraus, der eine Textunterlegung in englischer Sprache hinzugefügt war; als Vorlage für J2 diente J1a, ein mit diversen Eintragungen versehenes Exemplar von J1. Als Stimmenmaterial erschienen lediglich gedruckte Chorstimmen (K).
Im Jahre 1941 wurde von einem amerikanischen Kopisten eine Lichtpausabschrift der Chorstimmen nach der Vorlage J2 hergestellt; davon liegen Abzüge für jede Stimme (L) vor.
(Okuljar, Tadeusz; Sichardt, Martina: GA, Reihe B, Bd. 18, Teil 1, S. 5) | | Besetzung: | Gemischter Chor | | Gattung: | Chorwerke --> Chorstücke
| | Text: | Text nach GA:
Da die Hirten ihre Herde
Ließen und des Engels Worte
Trugen durch die niedre Pforte
Zu der Mutter und dem Kind,
Fuhr das himmlische Gesind
Fort im Sternenraum zu singen,
Fuhr der Himmel fort zu klingen:
„Friede, Friede auf der Erde!“ Seit die Engel so geraten,
O wie viele blut'ge Taten
Hat der Streit auf wildem Pferde,
Der Geharnischte vollbracht!
In wie mancher heil'gen Nacht
Sang der Chor der Geister zagend,
Dringlich, flehend, leis verklagend:
„Friede, Friede auf der Erde!“
Doch es ist ein ew'ger Glaube,
Daß der Schwache nicht zum Raube
Jeder frechen Mordgebärde
Werde fallen alle Zeit.
Etwas wie Gerechtigkeit
Webt und wirkt in Mord und Grauen,
Und ein Reich will sich erbauen,
Das den Frieden sucht der Erde. Mählich wird es sich gestalten,
Seines heil'gen Amtes walten,
Waffen schmieden ohne Fährde,
Flammenschwerter für das Recht,
Und ein königlich Geschlecht
Wird erblühn mit starken Söhnen,
Dessen helle Tuben dröhnen:
„Friede, Friede auf der Erde!“ Text nach Vorlage: Friede auf Erden.
Da die Hirten ihre Herde
Ließen und des Engels Worte
Trugen durch die niedre Pforte
Zu der Mutter und dem Kind,
Fuhr das himmlische Gesind
Fort im Sternenraum zu singen,
Fuhr der Himmel fort zu klingen:
„Friede, Friede! auf der Erde!" Seit die Engel so geraten,
O wie viele blut'ge Thaten
Hat der Streit auf wildem Pferde,
Der geharnischte, vollbracht!
In wie mancher heil'gen Nacht
Sang der Chor der Geister zagend,
Dringlich flehend, leis verklagend:
„Friede, Friede ... auf der Erde!"
Doch es ist ein ew'ger Glaube,
Daß der Schwache nicht zum Raube
Jeder frechen Mordgebärde
Werde fallen allezeit:
Etwas wie Gerechtigkeit
Webt und wirkt in Mord und Grauen
Und ein Reich will sich erbauen,
Das den Frieden sucht der Erde.
Mählich wird es sich gestalten,
Seines heil'gen Amtes walten,
Waffen schmieden ohne Fährde,
Flammenschwerter für das Recht,
Und ein königlich Geschlecht
Wird erblühn mit starken Söhnen,
Dessen helle Tuben dröhnen:
Friede, Friede auf der Erde!
(Gedichte / von / Conrad Ferdinand Meyer. Fünfte vermehrte Auflage. Leipzig: Verlag von H. Haessel 1892, S. 255-256) | | beteiligte Personen: | Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898) - Textautor(in)
|
| | Erstdruck: | Tischer & Jagenberg G.m.b.H. Köln 1912 | | Gesamtausgabe: | Reihe A, Bd. 18, S. 7-35; Reihe B, Bd. 18, Teil 1, S. 5-37; Skizzen: Reihe B, Bd. 18, Teil 1, S. 33-36 |
zurück
|
|